Типikon als Stimmgabel des kirchlichen Lebens: die Vorschrift über das Fasten
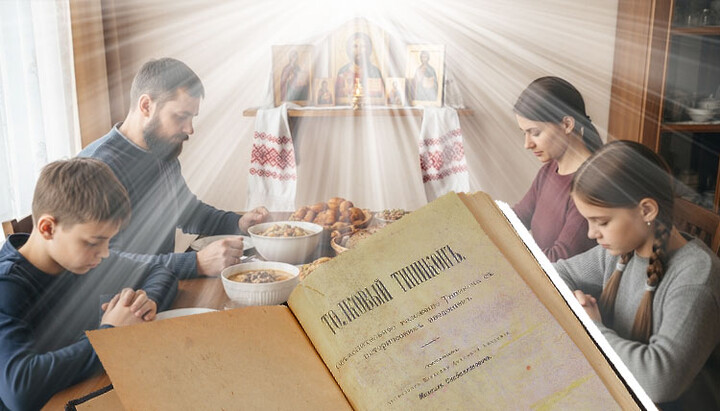
Viele glauben, dass man streng "nach dem Statut" fasten muss. Was schreibt das Typikon tatsächlich über das Fasten vor und wie steht es im Verhältnis zu unserem kirchlichen Leben?
Fasten – eines der am meisten diskutierten Themen im kirchlichen Leben. Oft hört man von der Unabänderlichkeit der Regeln, von der Notwendigkeit, «wie es sich gehört» zu fasten, sowie den Standardaussagen: «Die Kirche hat festgelegt», «die Vorschrift schreibt vor» und so weiter.
Aber das Problem bleibt das gleiche: Kaum jemand weiß, wie es tatsächlich «laut Vorschrift» sein soll.
Die meisten Menschen orientieren sich an Gewohnheiten, lokalen Traditionen, den Worten «ihres Priesters» und Broschüren zweifelhafter Herkunft, die nichts mit dem Typikon zu tun haben.
Die Regeln zum Fasten haben sich über Jahrhunderte entwickelt. In verschiedenen Regionen und Klöstern verlief dieser Prozess sehr autonom. Wie bereits im vorherigen Artikel erwähnt, hat sich in unserer Kirche die Vorschrift eines bestimmten Klosters durchgesetzt – der Lavra des ehrwürdigen Sabas des Geheiligten. Sein Klima, die Vegetation, die Verfügbarkeit von Lebensmitteln und die Lebensweise der Brüder beeinflussten direkt die Fastenvorschriften. Zum Beispiel wurden Meeresfrüchte in dieser Region oft durch die Vorschrift erlaubt, da sie einfache und nahrhafte Nahrung darstellten. Wird diese Regel dort Sinn machen, wo Fisch eine teure Delikatesse ist? Offensichtlich nicht.
Wie war das Fasten vor dem Erscheinen der Vorschriften?
Ursprünglich verstand man unter Fasten nicht die Einschränkung bestimmter Nahrungsmittelarten, sondern den vollständigen Verzicht auf Nahrung. Dementsprechend wurde die Strenge des Fastens durch seine Dauer gemessen: Es konnte der Verzicht auf Nahrung bis zum Mittag, bis drei Uhr nachmittags oder bis zum Abend sein.
In den Schriften der heiligen Väter finden wir genau dieses Verständnis: «Lasst uns nicht denken, dass das bloße Nichtessen bis zum Abend für unser Heil ausreicht... was nützt das Fasten, sag mir, wenn du den ganzen Tag nichts isst, aber dich den ganzen Tag Spielen, Scherzen, sogar Meineid und Verleumdung hingibst» (hl. Johannes Chrysostomus).
So unterschieden sich die Fasten ursprünglich nur in ihrer Dauer und waren von drei Typen:
- Fasten am Mittwoch und Freitag dauerte bis zur 9. Stunde (nach unserer Zeit bis 15:00 Uhr).
- Verzicht auf Nahrung in der Großen Fastenzeit endete mit dem Einbruch des Abends (etwa 18:00 Uhr).
- Strenges Fasten, bei dem der ganze Tag ohne Nahrung verbracht wurde. So soll am Karfreitag gefastet werden.
Später begannen sich die Formen des Fastens zu erweitern. Zuerst erschien der Verzicht auf Fleisch, dann – auf Milchprodukte und Eier. Bis zum 5. Jahrhundert hatte sich die Praxis, sich im Fasten nicht nur zeitlich, sondern auch in der Art der Nahrung einzuschränken, endgültig herausgebildet. Allmählich wurden solche Formen des Verzichts wie Rohkost und Trockenfasten in die Praxis aufgenommen. So wurden die Hauptbestandteile des Fastens Zeit, Menge und Art der Nahrung. Dieses System bildete die Grundlage der heutigen Vorschriften des Typikon.
Was sagt das Typikon tatsächlich über das Fasten?
Beginnen wir damit, dass es nicht mehr als zwei Mahlzeiten pro Tag im Laufe des Jahres vorsieht. Wenn nur eine Mahlzeit vorgesehen ist, findet sie zur 9. Stunde (etwa 15:00 Uhr) oder nach der Vesper statt.
Dabei lassen sich gemäß dem Typikon mehrere Fastenstufen unterscheiden:
- Erlaubnis «für alles» – keine Einschränkungen (außer Fleisch für Mönche).
- Erlaubnis für Fisch, Öl (pflanzliches Öl) und Wein.
- Erlaubnis für gekochte Speisen mit Öl und Wein.
- Erlaubnis für warme Speisen ohne Öl.
- Trockenfasten. Erlaubt sind «Brot und Wasser und Ähnliches», das heißt rohe, getrocknete oder eingelegte Gemüse und Früchte.
- Vollständiger Verzicht auf Nahrung und Trinken – das, was im Typikon eigentlich als «Fasten» bezeichnet wird.
Übrigens wurde Wein in der byzantinischen Tradition überall konsumiert, mit heißem Wasser verdünnt und enthielt nicht viel Alkohol. Daher erlaubt die Vorschrift ihn oft, gibt aber die Menge an.
Die allgemeine Ordnung der Mahlzeiten ist im 35. Kapitel des Typikon beschrieben. Mittwoche und Freitage (und in Klöstern – auch Montage) im Laufe des Jahres werden den Tagen der Großen Fastenzeit gleichgestellt – es ist einmal am Tag Trockenfasten vorgesehen. Feiertage können das Fasten lockern.
Als Beispiel geben wir ein Muster der Einhaltung des nicht strengen Petrusfastens nach der Vorschrift. Die Nahrungsaufnahme – einmal am Tag (etwa 15:00 Uhr). An gewöhnlichen Tagen – gekochte Speisen ohne Öl. Am Montag, Mittwoch und Freitag – Trockenfasten. Am Samstag und Sonntag sind Fisch und zwei Mahlzeiten erlaubt. Natürlich sind die Anforderungen an die anderen mehrtägigen Fasten viel strenger.
Interessant, ob diejenigen, die vom Fasten «nach der Vorschrift der Kirche» sprechen, solche Regeln meinen?
Was sind die Schlussfolgerungen?
Wir haben gesehen, wie sich das Fasten im Laufe der Jahrhunderte verändert hat – von vollständigem Nichtessen bis zu komplexen Schemata. Das Typikon ist streng, detailliert und wenig ähnlich zu den Vorstellungen, die oft in der modernen kirchlichen Umgebung vorherrschen.
Aber die Hauptfrage bleibt: Wie lässt sich das alles mit dem Leben eines Laien heute in Einklang bringen? Was von den Vorschriften ist möglich, vernünftig und wirklich nützlich? Wo ist die Grenze zwischen der Befolgung der Tradition und der geistigen Flexibilität?
Die Antworten auf diese Fragen erfordern keine voreiligen Schlüsse, sondern einen aufmerksamen Blick auf die Geschichte, den Menschen und den Kontext seines Lebens.
Die Vorschrift, wie eine Stimmgabel, gibt den Ton an, aber um die Musik des Glaubens zu spielen, muss man sowohl die Noten als auch den Atem der Epoche und die Möglichkeiten seiner Seele verstehen.
Und wenn man auf diese mittelalterliche Partitur schaut, wird klar, dass der moderne Christ kein verschlüsseltes Muster, sondern ein lebendiges Verständnis braucht.









